Donnerstag, 5. November 2015, 19.00 Uhr
Sabrina Janesch (2009 „Stadtschreiberin der Stadt Danzig“) liest aus ihrem Roman „Ambra“
Autorenlesung, 5. November 2015, 19.00 Uhr
SABRINA JANESCH (2009 „STADTSCHREIBERIN DER STADT DANZIG“) LIEST AUS IHREM ROMAN „AMBRA“

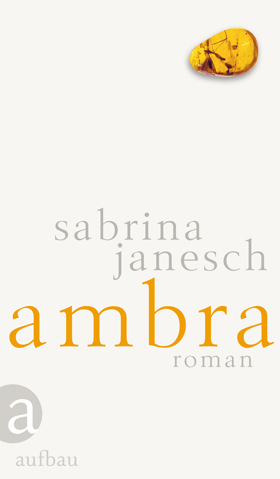

Es ist Herbst, als Kinga Mischa in der fernen, windumtosten Stadt am Meer eintrifft und dort ihrer polnischen Verwandtschaft, der Familie Mysza, begegnet. Nur ein Bernstein, in dem eine Spinne gefangen ist, erinnert die junge Frau an ihren verstorbenen Vater. Noch ahnt sie nur, dass der Träger des Steins nicht bloß das Schmuckstück, sondern auch eine seherische Gabe geerbt hat: eine faszinierende wie dunkle Fähigkeit, die für Kinga zunehmend zur Qual wird. – In ihrem Roman „Ambra“ entfaltet Sabrina Janesch eine zauberhafte Geschichte, die aus den widerstreitenden Perspektiven einer Spinne, eines Stadtschreibers und einer jungen Deutschpolin erzählt wird – mit viel Poesie, Raffinesse und Wärme. Sie schreibt die Chronik einer deutsch-polnischen Familie, die vom stetigen Wandel und einer dunklen Gabe geprägt ist, und zeigt die seelischen Verletzungen der Menschen, die mit der schmerzvollen Geschichte einer ungewöhnlichen Stadt korrespondieren: Fünf Jahrzehnte nach der »Blechtrommel« porträtiert Sabrina Janesch eine Stadt, in die die rätselhafte Geschichte der Myszas eingeschlossen ist wie in einen Bernstein.
Diesen Roman stellt die Autorin bei ihrer Lesung im Rahmen des Begleitprogramms zur Sonderausstellung „Danzig im Luftbild der Zwischenkriegszeit“ im Westpreußischen Landesmuseum vor.
Sabrina Janesch, 1985 in Gifhorn geboren, studierte Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus in Hildesheim und Polonistik in Krakau. Sie erhielt mehrere Stipendien und Preise, 2009 war sie die erste Stadtschreiberin von Danzig. 2010 erschien ihr vielbeachtetes Debüt „Katzenberge“, 2012 ihr Roman „Ambra“, für den ihr u.a. das Arbeitsstipendium des Landes Nordrhein-Westfalen zugesprochen wurde; 2014 folgte der Roman „Tango für einen Hund“. Momentan arbeitet sie an ihrem vierten Roman.
Samstag, 19. September 2015, 17.30 Uhr
Angekommen. Flüchtlinge und Vertriebene:
damals – und heute
Begegnungen über Ländergrenzen und Generationen hinweg
Eine aktuelle Podiumsdiskussion
Podiumsdiskussion, 19. September 2015, 17.30 Uhr
Angekommen. Flüchtlinge und Vertriebene: damals – und heute
Begegnungen über Ländergrenzen und Generationen hinweg
Flucht und Vertreibung von mehr als zwölf Millionen Deutschen nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges führten zur größten Zwangsmigration in der europäischen Geschichte. Heute sind wieder hunderttausende Heimatlose auf erzwungenen Wegen, um zwischen Hamburg und München, zwischen Köln und Berlin irgendwo in unserem Land Aufnahme zu finden. Waren es damals Deutsche, die in Folge eines Weltkrieges ihre Heimat verloren, so sind es heute Menschen vor allem aus dem arabischen und afrikanischen Raum, denen es islamistischer Terror, Bürgerkriege oder brutale Diktaturen verwehren, länger in ihrer Heimat zu leben oder dorthin zurückzukehren.
Die historischen Zusammenhänge und Ursachen sind unterschiedlich – die menschlichen Erfahrungen, die die Betroffenen machen müssen, sind jedoch vergleichbar: Der Verlust, nicht nur der Habe, sondern auch des gewohnten Lebensumfeldes – Entwurzelung im wahrsten Sinne des Wortes, oder Hoffnungen und Enttäuschungen auf der Flucht und bei Ankunft in dem Land, das vielleicht einmal eine «neue Heimat» wird. Damals wie heute betrifft die Flucht jedoch nicht nur die Flüchtlinge, sondern stellt auch Herausforderungen an die aufnehmende Gesellschaft: Wie kann Fremdheit überwunden werden? Wie kann aus Kälte Geborgenheit werden? Vielleicht irgendwann wieder neue «Beheimatung»?
Über diese Erfahrungen und Herausforderungen der Vergangenheit und Gegenwart möchten wir ins Gespräch kommen und laden herzlich zu einer Podiumsdiskussion ein. Auf dem Podium nehmen daran teil:
- GEORG BURHOLT: Der pensionierte Deutschlehrer unterrichtet und betreut seit Jahren ehrenamtlich Flüchtlinge im Kreis Warendorf.
- JAKLEEN GERGES: Die Angehörige der christlichen Minderheit der Kopten floh vor der Verfolgung aus Ägypten.
- MERLE HILBK: Die Berliner Journalistin arbeitet seit Jahren über die kulturellen und psychologischen Folgen von Flucht und Vertreibung.
- SIEGFRIED SIEG: Der Stiftungsratsvorsitzende der Kulturstiftung Westpreußen erlebte als Kind die Vertreibung aus der Freien Stadt Danzig.
- Die Moderation übernehmen LEA AUFFARTH, freie Journalistin, u.a. beim WDR, (Dortmund), und TILMAN ASMUS FISCHER, Historiker und freier Autor (Berlin).
Sprechen werden des Weiteren der Schirmherr der Veranstaltung, JOCHEN WALTER, Bürgermeister der Stadt Warendorf, sowie ANNEGRET SCHRÖDER, Witwe des letzten Bundesvertriebenenministers, Heinrich Windelen, und selbst in der Flüchtlingsarbeit aktiv. Im Anschluss an das Gespräch mit den Podiumsgästen freuen wir uns darauf, in der Diskussion auch mit dem Auditorium ins Gespräch zu kommen.
Bei dieser Veranstaltung handelt es sich um den letzten Teil des Begleitprogramms zur Sonderausstellung «Angekommen. Die Integration der Vertriebenen in Deutschland», die noch bis zum 27. September im Westpreußischen Landesmuseum zu sehen ist.
Hier sind die Texte der Ansprachen von Bürgermeister Jochen Walter (Keynote) bzw. von Annegret Schröder (Schlusswort der Veranstaltung) verfügbar.
Texte der beiden Ansprachen:
- Keynote von Jochen Walter, dem Bürgermeister der Stadt Warendorf
- Schlusswort der Veranstaltung, gehalten von Annegret Schröder, der Witwe von Bundesvertriebenenminister a.D. Dr. Heinrich Windelen
Donnerstag, 10. September 2015, 19.00 Uhr
Flucht, Vertreibung, Aussiedlung – und die Ankunft im Westen Deutschlands
Berichte von Zeitzeugen aus Westpreußen
Berichte von Zeitzeugen aus Westpreußen
10. September 2015, 19 Uhr
Flucht, Vertreibung, Aussiedlung – und die Ankunft im Westen Deutschlands
Nach dem Dokumentarfilm „Weder hier noch dort“ von Margit Eschenbach, der in der vergangenen Woche gezeigt worden ist, werden im Begleitprogramm der Sonderausstellung „Angekommen“ drei Zeitzeugen aus Westpreußen über ihre persönlichen Erfahrungen aus der Nachkriegszeit sprechen. Sie werden schildern, unter welchen Bedingungen sie jeweils auf langen, schwierigen Wegen, die in einem Fall eine Spanne von weit mehr als zehn Jahren beansprucht haben, endlich „ankommen“ durften. Der Verlust der Heimat, der Kampf um das pure Überleben sowie der Neubeginn nach Flucht und Vertreibung kommen folglich in sehr unterschiedlichen Perspektiven zur Sprache.
Brunhild Bethke (Hannover), Fritz Jabs (Düsseldorf) und Siegfried Sieg (Bochum) wollen sich der keineswegs einfachen Aufgabe unterziehen, ihre individuellen, oft sehr persönlichen und auch belastende Erinnerungen zu schildern. Dabei werden sie selbstverständlicher Weise nicht distanziert „Vorträge“ halten, sondern einen Gesprächskreis bilden, der das Publikum von Beginn an mit einschließen will.
Donnerstag, 3. September 2015, 19.00 Uhr
„Weder hier noch dort“
Ein Dokumentarfilm von Margit Eschenbach
Filmvorführung und Diskussion, 3. September 2015, 19 Uhr
Weder hier noch dort
Ein Dokumentarfilm von Margit Eschenbach
Der 2007 produzierte Dokumentarfilm „Weder hier noch dort“ widmet sich dem Kriegsende aus der Perspektive damaliger Flüchtlingskinder: Drei Frauen und zwei Männer sprechen über ihre sehr unterschiedlichen Erfahrungen und die Bedeutung, die sie dem Verlust der Heimat bis heute zumessen. Dabei erkundet Margit Eschenbach (mit einer Formulierung des Medienwissenschaftlers Axel Doßmann) „ihr Thema so erhellend unaufgeregt, mit einer Neugier für Geschichten und Erzählweisen, die bei dem Reizwort Vertreibung nicht selbstverständlich sind“.
Margit Eschenbach, Filmemacherin, Hochschullehrerin und Fotografin, hat sich in mehreren dokumentarischen Arbeiten mit dem Verlust der Heimat oder dem Neubeginn nach Flucht und Vertreibung auseinandergesetzt, aber auch die Probleme erkundet, die sich Nachgeborenen stellen, wenn sie sich dem fremd gewordenen fernen Land nähern wollen, in dem früher einmal die eigene Familie gelebt hat.
Sonntag, 19. Juli 2015, 11 Uhr
Prof. Dr. Erik Fischer (Bonn)
Sonderführung: „Westpreußen in 15 Objekten“
Sonderführung
Prof. Dr. Erik Fischer (Bonn)
Westpreußen in 15 Objekten
Neil MacGregor, gegenwärtig noch Direktor des „British Museum“, hat 2010 den aufmerksam verfolgten, spannenden Versuch unternommen, anhand von 100 Objekten nicht weniger als „Eine Geschichte der Welt“ zu erfassen. Demgegenüber setzt sich die Sonderführung einen deutlich bescheideneren Anspruch: Das Feld – Westpreußen – ist leicht zu überschauen, und auch eine Anzahl von nur 15 Stücken dürfte nicht abschreckend wirken.

Der Ansatz ist demjenigen von MacGregor aber durchaus vergleichbar. Er verzichtet bewusst darauf, durch eine Reihe von verwandten Exponaten einen größeren kulturgeschichtlichen Zusammenhang zu erzeugen, von dem aus das Einzelne dann wieder seinen Ort und seinen Sinn gewinnt. Stattdessen lässt er die Objekt eher als isolierte Relikte oder Fragmente erscheinen, die jeweils für sich wahrgenommen und interpretiert werden wollen: Welche Bedeutungen könnten ihnen zukommen? Lassen sich möglicherweise umfassendere Kontexte von ihnen aus erhellen?
Der Ausgangspunkt dieses experimentellen Konzepts ist von denjenigen traditioneller Verfahren somit deutlich getrennt. Gleichwohl führen beide Wege letztlich zum selben Ziel: der Vermittlung eines ersten Überblicks über die Konzeption und die Sammlung eines Museums.
Prof. Dr. Erik Fischer, lehrte bis zum Herbst 2014 Musik- und Medienwissenschaft an der Universität Bonn; 2005 Mitbegründer und (bis 2012) erster Sprecher des dortigen Zentrums für Kulturwissenschaft/Cultural Studies.
Sonntag, 5. Juli 2015, 11–16.30 Uhr
Eine Zukunft für „Westpreußen“ – Symposion zur Geschichte und Weiterentwicklung des Westpreußischen Landesmuseums in Warendorf
Symposium am Sonntag, 5. Juli 2015, 11–16.30 Uhr
Eine Zukunft für „Westpreußen“ – Symposion zur Geschichte und Weiterentwicklung des Westpreußischen Landesmuseums in Warendorf
11.00–13.15 Uhr
Erik Fischer (Dortmund)
Einführung
Hans-Jürgen Schuch (Münster)
Wie es zum Westpreußischen Landesmuseum kam
Jutta Reisinger-Weber (Breuberg)
Vom systematischen Sammeln und von florierenden West-Ost-Kontakten
Lothar Hyss (Warendorf)
Zu neuen Ufern – Von Wolbeck nach Warendorf
13.15–14.15 Uhr
Mittagspause mit kleinem Imbiss
14.15–16.30 Uhr
Michael Wienand (Dortmund)
Das neue Westpreußische Landesmuseum – Ein Museum aus einem Guss
Alexander Kleinschrodt (Bonn)
Von den Chancen, unverwechselbar zu sein
Tilman Asmus Fischer (Berlin)
Erträge und offene Fragen
Schlussdiskussion
Samstag, 20. Juni 2015, 11 Uhr
Prof. Dr. Klaus Hänsch, Präsident des Europäischen Parlaments a.D.
Das Gedenken an Flucht und Vertreibung in einem geeinten Europa. Perspektiven eines westpreußischen Landesmuseums
Festvortrag zur Eröffnung der Ausstellung Das Westpreußische Landesmuseum 1975–2015: 40 Jahre Westpreußen in Westfalen
Dieser Vortrag ist ins Polnische übersetzt und 2016 publiziert worden (ISBN 978-3-00-051803-4). Die zweisprachige Broschüre ist hier als PDF-Datei verfügbar. Exemplare der Print-Version sind noch bei der Geschäftsstelle erhältlich und können dort per E-Mail – info@kulturstiftung-westpreussen.de – bestellt werden.
Donnerstag, 28. Mai 2015, 19 Uhr
Prof. Dr. Erik Fischer (Bonn)
Vortrag: „Hildegard von Bingen und die Universalität des Mittelalters“
Vortrag am 28. Mai 2015
Prof. Dr. Erik Fischer (Bonn)
Hildegard von Bingen und die Universalität des Mittelalters
Seit dem späten 20. Jahrhundert wird Hildergard von Bingen (1098–1179) sogar in der allgemeinen Öffentlichkeit wahrgenommen und gilt heute als herausragende Frauenfigur des Mittelalters. Die gesteigerte Aufmerksamkeit beruht zum einen auf den bedeutungsgesättigten und bildkräftigen Visionen, die Hildegard, eine Benediktinerin (und spätere Äbtissin), schon in ihrer Zeit berühmt gemacht haben und die sie der Nachwelt hinterlassen hat.


Zum andern fasziniert sie die Menschen durch die Breite ihrer Gelehrsamkeit, die sich in einer großen Vielfalt von Schriften niedergeschlagen hat. Hildegard äußert sich tiefgründig zu theologischen, aber auch philosophischen Problemen, beschreibt differenziert die Natur – von den Tieren über die Pflanzen bis zu den Steinen– und beschäftigt sich mit dem Kosmos gleichwie mit Fragen der Medizin. Darüber hinaus verfasst sie Dichtungen und komponiert musikalische Werke. In seinem umfassenden Charakter spiegelt ihr Schaffen beispielhaft das geschlossene, harmonische Weltbild des Mittelalters wider. Auch wenn diese „Universalität“ einer schon fernen Epoche angehört, verdient sie nicht nur unser historisches Interesse; denn oft gewinnen diese Anschauungen und Modelle beispielsweise in der gegenwärtigen Naturheilkunde oder Ökologie eine überraschende Aktualität.
Prof. Dr. Erik Fischer, lehrte bis zum Herbst 2014 Musik- und Medienwissenschaft an der Universität Bonn; 2005 Mitbegründer und (bis 2012) erster Sprecher des dortigen Zentrums für Kulturwissenschaft/Cultural Studies.
Donnerstag, 7. Mai 2015, 19 Uhr
Prof. Dr. Klaus Militzer (Köln)
Vortrag: „Jagd und Adelsfeste im Deutschen Orden“
Vortrag am Donnerstag, 7. Mai 2015, 19 Uhr
Prof. Dr. Klaus Militzer (Köln)
Jagd und Adelsfeste im Deutschen Orden
Die Jagd war den Brüdern des Deutschen Ordens im Allgemeinen verboten und nur ausnahmsweise gestattet. Zumindest seit dem 14. Jahrhundert pflegten jedoch die Hochmeister mit den Großgebietigern und anderen Ordensangehörigen durchaus zu jagen. Sie luden dazu auch adlige Preußen oder Litauerfahrer ein. Da diese Litauerfahrer denselben Familien entstammten wie die Adligen, die Preußen aufsuchten, brachten sie ihre Vorstellungen eines standesgemäßen Lebens mit. Dazu zählten Turniere, Gastmähler, Spiele und anderes. Viele Ordensbrüder in der Marienburg wie in Königsberg ahmten jedenfalls die Gewohnheiten dieser Adligen nach. Dazu gehörte auch die einschränkungslose Jagd. Ob auch andere Vorstellungen übernommen worden sind, bleibt recht ungefähr. Allerdings standen der Nachahmung gewisse Grenzen entgegen, vor allem was Frauen betraf. Abgesehen von Bürgerinnen und Prostituierten in Königsberg gab es ansonsten keine Frauen: In die Burgen des Ordens konnten sie nicht vordringen.
Prof. Dr. Klaus Militzer, geboren 1940 in Bielefeld; nach Promotion (1968) und Habilitation (1978) an der Universität Göttingen Privatdozent dortselbst, seit 1993 an der Ruhr-Universität Bochum; von 1994 bis 2005 apl. Professor für mittelalterliche Geschichte in Bochum. – Zudem von 1979 bis 2005 Wissenschaftlicher Referent am Historischen Archiv der Stadt Köln. Mitglied in verschiedenen historischen Vereinen und Kommissionen.
Aus einer Vielzahl von einschlägigen Publikationen seien genannt:
- Probleme der Migration und Integration im Preußenland vom Mittelalter bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts. Hrsg. von Klaus Militzer (Tagungsberichte der Historischen Kommission für Ost- und Westpreußische Landesforschung 21), Marburg 2005
- Die Geschichte des Deutschen Ordens, Stuttgart 2005 (auch in polnischer und lettischer Übersetzung), 2. Auflage, Stuttgart 2012
Donnerstag, 26. März 2015, 19 Uhr
Dr. Jens Stüben (Oldenburg):
Vortrag: „Danzig als literarischer Raum und Ort der Erinnerung bei Günter Grass und Sabrina Janesch“
Vortrag am Donnerstag, 26. März 2015
Dr. Jens Stüben (Oldenburg)
Danzig als literarischer Raum und Ort der Erinnerung bei Günter Grass und Sabrina Janesch
Der Vortrag beschäftigt sich mit Aspekten der literarischen Gestaltung der Stadt Danzig als Ort der Erinnerung und als aktueller Handlungsschauplatz im Werk von Günter Grass und im Roman „Ambra“ von Sabrina Janesch. Gezeigt werden soll, wie Grass den historischen Ort ausgestaltet, mit welchen epischen Mitteln er Erinnerung provoziert und festhält. Intertextuelle Reminiszenzen an Grass, aber auch die eigene Sichtweise ihrer Protagonistin sind Gegenstand des abschließenden Blicks auf Janeschs 2012 erschienenen Roman, in dem sie Danzig als symbolischen Erinnerungsort präsentiert.
Dr. Jens Stüben, Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, Oldenburg (seit 1992). Studium der Germanistik in Kiel und Bonn, Promotion in Bonn, Mitarbeiter im Bereich Literatur- und Editionswissenschaft an den Universitäten Münster, Osnabrück und Oldenburg. – Arbeitsschwerpunkte: Autorinnen und Autoren aus Westpreußen, Ostpreußen, Schlesien und Altösterreich.